von Quinn Slobodian
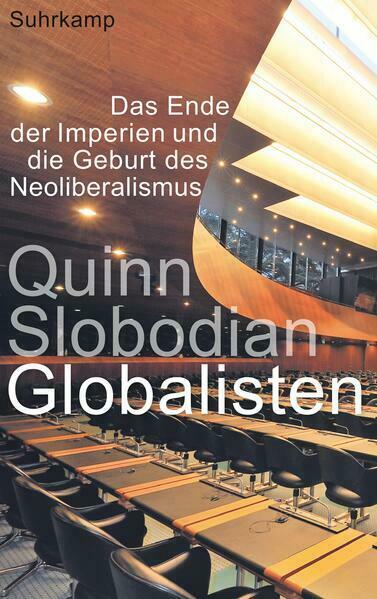
| Übersetzung: |
Stephan Gebauer |
| Verlag: |
Suhrkamp |
| Format: |
Sozialwissenschaften allgemein |
| Umfang: |
522 Seiten |
| Erscheinungsdatum: |
11.11.2019 |
| Preis: |
€ 32,90 |
Kurzbeschreibung des Verlags:
Nachdem Handelspolitik lange eine Sache spezialisierte Juristen war, ist sie heute ein Feld heftiger politischer Auseinandersetzungen: Beim Brexit steht der freie Warenverkehr auf dem Spiel, Donald Trump droht deutschen Autobauern mit Schutzzöllen.
In seinem Buch, das in der englischsprachigen Welt für Furore sorgt, wirft Quinn Slobodian einen neuen Blick auf die Geschichte von Freihandel und neoliberaler Globalisierung. Im Mittelpunkt steht dabei eine Gruppe von Ökonomen um Friedrich von Hayek und Wilhelm Röpke. Getrieben von der Angst, nationale Massendemokratien könnten durch Zölle oder Kapitalverkehrskontrollen das reibungslose Funktionieren der Weltwirtschaft stören, bestand ihre Vision darin, den Markt auf der globalen Ebene zu verrechtlichen und so zu schützen.
Slobodian begleitet seine Protagonisten durch das 20. Jahrhundert. Er zeigt, wie sie auf neue Herausforderungen – die Entkolonialisierung etwa oder die europäische Integration – reagierten und aus einer Außenseiterposition heraus die Deutungshoheit eroberten. Quinn Slobodian, geboren 1978 im kanadischen Edmonton, ist Associate Professor am Department of History des Wellesley College. Seine Spezialgebiete sind deutsche Geschichte, soziale Bewegungen und das Verhältnis zwischen den Industrieländern und dem globalen Süden.
Rezension zu "Globalisten. Das Ende der Imperien und die Geburt des Neoliberalismus" von Quinn Slobodian
Der Erste Weltkrieg wird oft als Urkatastrophe des kurzen 20. Jahrhunderts bezeichnet. Wie Quinn Slobodian in seinem Buch Globalisten zeigt, wurde diese Einschätzung auch und gerade von einer Gruppe von Denkern geteilt, die gemeinhin als Neoliberale adressiert werden – wenn auch aus ganz besonderen Gründen. Aus ihrer Perspektive war 1914 nämlich eine ganze liberale Welt zusammengebrochen. Es handelte sich um eine Welt, die größtenteils aus Nationalstaaten bestand, allerdings von Imperien dominiert wurde und in der britische Kriegsschiffe die Pax Britannica durchsetzten. Dieser ‚hundertjährige Friede‘ (Karl Polanyi) ermöglichte in Kombination mit dem Goldstandard Welthandel in einer Größenordnung, wie sie erst wieder im Zeitalter der gegenwärtigen Globalisierung erreicht werden sollte.
Die Kernthese Slobodians lautet, dass diese globale Dimension, die von derart großer Bedeutung für die Existenz der mit dem Ersten Weltkrieg zerstörten liberalen Welt gewesen war, nach wie vor eine herausragende Rolle im Denken jener Gruppe von Neoliberalen spielte, die er als „Genfer Schule“ bezeichnet: es sind diese Globalisten, auf die sich der Titel des Buchs bezieht.
Den Genfern, zu denen Slobodian bekanntere Denker wie Friedrich August von Hayek, Ludwig von Mises und Wilhelm Röpke, aber auch unbekanntere wie etwa Michael Heilperin und Gottfried Haberler zählt, erschien die Welt am Ende des ‚Großen Krieges‘ als eine, die zunehmend unter rivalisierenden Nationalstaaten aufgeteilt war, deren Massendemokratien auf bedenkliche Weise dem Sozialismus oder ‚ökonomischen Nationalismus‘ zuneigten – sei es, weil sie planwirtschaftliche Elemente ins Spiel brachten oder bereit waren, Handelsbarrieren zu errichten. Diese Situation verschärfte sich durch eine weitere Zäsur, auf deren Auswirkungen die Genfer reagierten: die Weltwirtschaftskrise, angesichts derer das liberale Credo von den Vorzügen freier Märkte zunehmend zynisch wirkte und die zudem den zaghaften Versuchen, die ökonomischen Grundbedingungen der liberalen Welt des 19. Jahrhunderts etwa in Form des Goldstandards wiederherzustellen, eine Ende bereitete. Die dritte jener Zäsuren, die von zentraler Bedeutung in Slobodians Narrativ sind, ereignete sich allerdings erst sehr viel später, nämlich in den 1970er-Jahren, als eine Gruppe gerade entkolonialisierter Länder bessere Konditionen im Welthandel einforderte und kraft der mit diesen Ansprüchen verbundenen Agenda einer Neuen Weltwirtschaftsordnung das GATT-Regime faktisch in Frage stellte. Wie Slobodian in meisterhafter Manier zeigt, reagierte die Genfer Schule auf jede dieser Zäsuren mit Strategien, die nicht so sehr darauf abzielten, einen wie auch immer gearteten liberalen Status Quo ante wiederherzustellen – handelte es sich doch um Neo- und nicht um Retroliberale. Vielmehr sollte sichergestellt werden, dass der globale Handel unabhängig von und ungestört durch die jeweiligen politischen Ordnungen vonstattengehen konnte. Ausgedrückt in der konzeptionellen Sprache des Römischen Rechts, die Röpke und andere Neoliberale aufgriffen, galt es, die Welt des dominium, das heißt von Eigentum, Handel und Finanzen, vor den Beeinträchtigungen zu schützen, die von der Welt des imperium, das heißt von Nationen, Ländern und Völkern ausgingen. Konkret lief diese Programmatik darauf hinaus, die Rechte des Kapitals gegenüber (postkolonialen) Demokratien in Schutz zu nehmen; diese Demokratien also gewissermaßen im Interesse eines unbehelligten Welthandels zu ‚ummanteln‘.
Slobodian vollzieht nach, wie die Genfer Schule auf die genannten Zäsuren mit neuen Überlegungen und Entwürfen reagiert. In den 1920er-Jahren besteht die Antwort darin, die Weltwirtschaft in einer Weise zu modellieren und zu visualisieren, dass die vielfältigen Nachteile von Protektionismus und ‚Zollmauern‘ (tariff walls) möglichst suggestiv in Erscheinung treten. Doch ist diesen Versuchen kein nachhaltiger Erfolg beschieden, wie nicht zuletzt die Weltwirtschaftskrise und der mit ihr verbundene, grassierende Protektionismus belegen.
Die Lehre, die die Genfer aus den Unzulänglichkeiten jener „Welt der Zahlen“ (S. 81) zieht, lautet, dass sich die widerstreitenden Logiken von imperium und dominium am besten im Rahmen einer supranationalen Föderation ausbalancieren lassen. Unterschiedliche Entwürfe einer solchen Föderation finden sich etwa in den Werken von Lionel Robbins, Hayek oder Röpke, die freilich auf dieselbe Quintessenz hinauslaufen: Falls die supranationale Ebene solcher Föderationen ausschließlich die Macht habe, ‚nein zu sagen‘, wie Hayek formulierte, und damit die ungestörte Mobilität von Waren und Menschen zwischen womöglich divergierenden Jurisdiktionen sicherzustellen, dann ließen sich auf einem derartigen Binnenmarkt diverse Ziele verwirklichen: Es könnte sich nicht nur eine transnationale Arbeitsteilung mit den entsprechenden Spezialisierungseffekten entwickeln, vielmehr würde ein solcher Binnenmarkt einzelnen Jurisdiktionen auch die Macht entziehen, über ökonomische Akteure und ihre grenzübergreifenden Aktivitäten zu bestimmen. Sozusagen als Kompensation für diese Souveränitätsverluste bliebe den Menschen freilich vorbehalten, über kulturelle Fragen zu entscheiden, um etwaige nationalistische Bedürfnisse zu befriedigen.
Jedoch brachte das Ende des Zweiten Weltkriegs keineswegs eine „Welt der Föderationen“ (S. 133), sondern die Institutionalisierung der Vereinten Nationen, die auf ganz anderen Prinzipien beruhte. Slobodian zeichnet nach, wie sich die Genfer daraufhin in ihren Überlegungen dem Recht auf Kapitalbesitz und -transfer zuwenden, um das spannungsreiche Verhältnis zwischen imperium und dominium in ihrem Sinne auszutarieren. Michael Heilperin, ein langjähriges Mitglied der Mont Pèlerin Society, betonte etwa die Notwendigkeit, Kapitaleigentümer und ihre Rechte nicht nur vor Enteignungen, sondern auch vor Kapitalverkehrskontrollen zu schützen. Letztlich, so Heilperin, sei das Recht, ein Land zu verlassen und dabei freie Verfügungsgewalt über die Lokalität seines Kapitals zu besitzen, nicht weniger als ein Menschenrecht.
Diese „Welt der Rechte“ (S. 175) nahm im Nachkriegseuropa eine besondere Form an. 1957 wurde mit den Römischen Verträgen ein Binnenmarkt konstituiert, als dessen Rahmen eine ‚ökonomische Verfassung‘ fungierte, von der schon bei deutschen Ordoliberalen wie Walter Eucken und Franz Böhm die Rede gewesen war – wenn auch in nationalstaatlichen Zusammenhängen. Im Rahmen dieser ‚Verfassung‘ wurden die vier Grundfreiheiten (bezogen auf den freien Verkehr von Waren, Menschen, Kapital und Dienstleistungen) mit unmittelbarer Wirksamkeit (‚direct effect‘) ausgestattet, wie es in den entsprechenden Urteilen des Europäischen Gerichtshofs hieß. Dies bedeutet, dass natürliche und juristische Personen das Recht haben, vor nationale und europäische Gerichte zu ziehen, wenn sie der Auffassung sind, dass diese Rechte verletzt werden, sei es durch (nicht-tarifäre) Handelshemmnisse oder Gewerkschaften, die wiederum auf ihre Rechte pochen können – in den einschlägigen Rechtsstreiten aber zumeist unterlagen.
Freilich blieb, wie Slobodian herausarbeitet, die Genfer Schule gespalten was die Frage angeht, ob die Europäische Gemeinschaft tatsächlich das passende Modell für die Re-Liberalisierung des Welthandels darstellte oder doch eher als eine gigantische ökonomische Festung zu verstehen sei, die errichtet wurde, um ungewollte Konkurrenten vom Binnenmarkt fernzuhalten, also eigentlich nur einen ökonomischen Nationalismus auf höherer Ebene manifestiere. Diese Bedenken machten sich unter anderem an der bevorzugten Behandlung fest, die einstmalige imperiale Mächte wie Frankreich ihren ehemaligen Überseeterritorien zuteilwerden ließen. Und damit wendet sich Slobodian der globalistischen Wahrnehmung der ‚Entwicklungsländer‘ und ihrer vorwiegend nicht-weißen Bevölkerungen zu. Diese Perspektive auf eine „Welt der Rassen“ (S. 211) offenbart eine eher ungewöhnliche – oder womöglich durchaus gewöhnliche – Art von Liberalismus, etwa was die Annahmen über das zivilisatorische Niveau der Länder der Sub-Sahara oder die dort umso stärker ins Gewicht fallenden Defizite demokratischer Mehrheitsherrschaft angeht, die unweigerlich in der selbstzerstörerischen Herrschaft des ökonomischen Nationalismus und der damit verbundenen Gefahr für die Regeln des dominium enden müssten.
Den Schwerpunkt des letzten Kapitels legt Slobodian dann auf eine Rekonstruktion der Vorgeschichte der Welthandelsorganisation. Nachgezeichnet wird, wie Hayekianer aus der WTO ein Freihandelsregime zu formen versuchten, das Hayeks Einsichten bezüglich der Komplexität des (Welt-)Marktes als einem riesigen Informationsprozessor Rechnung tragen würde, der zwar einen bestimmten Rahmen benötige, jedoch keinerlei direkte Interventionen dulde. Im Namen einer „Welt der Signale“ (S. 311) sollte dem damaligen Trend in der Entwicklungsökonomik entgegengewirkt werden, die verstärkt auf makroökonomische Modellierungen im Dienste der oben erwähnten Neuen Weltwirtschaftsordnung setzte.
Die Stärken von Slobobians Buch, das von der American Historical Society mit dem „George Louis Beer-Preis“ für das beste Buch im Bereich internationaler europäischer Geschichte ausgezeichnet wurde, sind vielfältig: Globalisten präsentiert eine herausragende Forschungsleistung, die zudem durch außergewöhnlich gut geschriebene Prosa überzeugt. Es handelt sich, anders gesagt, um ein ausgesprochen akademisches Buch, das selbst dort lesbar bleibt, wo es sich mit den teils höchst undurchsichtigen und technischen Fragen des Welthandels befasst. Die Gesamtkomposition des Buches ist dabei überaus elegant; jedes Kapitel widmet sich einer bestimmten ‚Welt‘, so wie die Globalisten sie über die Zeit hinweg imaginierten und zu verwirklichen trachteten. Am wichtigsten sind zweifelsohne die äußerst originellen Funde und Befunde, an denen in Slobodians Studie keinerlei Mangel herrscht: Der Neoliberalismus ist kein anti-staatlicher Marktfundamentalismus, wie es nach wie vor vielerorts behauptet wird. Vielmehr versteht er den Staat als wichtigen Faktor in seinem Bestreben, die Welt des proprium zu sichern – wobei jener Staat gleichzeitig auch deren größte Bedrohung darstellt. Was Slobodians Narrativ hingegen so einzigartig macht, ist seine Refokussierung der Neoliberalismus-Forschung auf Herrschaftsstrukturen jenseits des Nationalstaats im Kontext von untergehenden rassistisch imprägnierten Imperien. Die Bedeutung dieser Ebenen und Kontexte ist in der bisherigen Forschung allenfalls unzureichend berücksichtigt worden. Slobodians Vorschlag, die Variationen des neoliberalen Denkens um eine Genfer Schule zu erweitern, wird zweifellos Folgestudien veranlassen, die uns ein mutmaßlich noch klareres Bild dieser Version von Neoliberalismus vermitteln werden, und zwar nicht nur in seiner Sichtweise auf die OECD-Welt, sondern auch auf den Globalen Süden.
Bisweilen überspannt Slobodian, das darf nicht unerwähnt bleiben, den Bogen seiner Kernthese ein wenig, ruft man sich etwa in Erinnerung, dass die meisten Neoliberalen, inklusive Hayek, trotz aller supranationalen Erwägungen vorwiegend eben doch im nationalstaatlichen Rahmen dachten. Aber das sind Vorbehalte und Fragen, die zukünftige Forschungsarbeiten hoffentlich aufgreifen werden, die ansonsten in Slobodians wichtigen Einsichten und Thesen ihren Ausgangspunkt finden sollten. Zweifelsohne liefert Globalisten sowohl (Ideen-)Historiker*innen wie politischen Theoretiker*innen eine überaus anregende Lektüre. Sein Narrativ endet zwar mit der Gründung der Welthandelsorganisation Mitte der 1990er-Jahre, aber es enthält eine Vielzahl von Implikationen für unsere Gegenwart: von Handelsabkommen wie TTIP und CETA bis hin zu einer Europäischen Union, in der die „ordoglobalistische“ Perspektive, wie Slobodian sie nennt, zur Etablierung eines Regimes der Austerität in Reaktion auf die Eurozonenkrise geführt hat, und einem Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, dessen Politik die Genfer zweifellos als ökonomischen Nationalismus und damit als einen Angriff der Welt des imperium auf diejenige des dominium gebrandmarkt hätten.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Martin Bauer.